Ich hatte am 17. August 2023 Prof. Kunz von der Uni Düsseldorf bei uns im Garten zu einem Interview zu Besuch. Er hat eine etwas andere Auffassung, wie Artenschutz in Deutschland gelingen und die Artenvielfalt erhöht werden kann. Seiner Auffassung nach ist nicht eine allgemeine Extensivierung das Mittel der Wahl, sondern eine gezielte Förderung derjenigen Arten, die vom Aussterben bedroht sind. Dazu ist aber eine Schaffung von sehr spezifischen Habitaten notwendig, denn die Ansprüche gerade seltener Arten sind sehr speziell. Deshalb sind sie auch selten geworden.
Um diese Habitate zu schaffen, sind gerade Landwirte sehr geeignet, weil sie über entsprechende Gerätschaften und das notwendige Know how verfügen. Ein offener und ehrlicher Umgang von Naturschützern mit Landwirten und von Landwirten mit Naturschützern ist bei der Zusammenarbeit sehr hilfreich.
Mit “Naturschützern” sind nicht unbedingt kommerzielle Vereine wie BUND e.V., NABU e.V. oder sonstige spendenfinanzierte Organisationen gemeint. Deren Umgang mit Landwirten ist selten offen und ehrlich. Persönlich habe ich gute Erfahrungen mit staatlichen Naturschützern oder unserer Biologischen Station gemacht, weil hier kommerzielle Interessen keine Rolle spielen und die Sache im Vordergrund steht.
Nach 21 Minuten bricht das Video aufgrund eines technischen Fehlers etwas abrupt ab, ich habe mich aber danach noch für das lehrreiche Gespräch bedankt.
Weil ich die Aussagen von Prof. Kunz so praxisnah und realistisch finde, würde ich mich freuen, wenn das Video eine hohe Verbreitung finden würde.
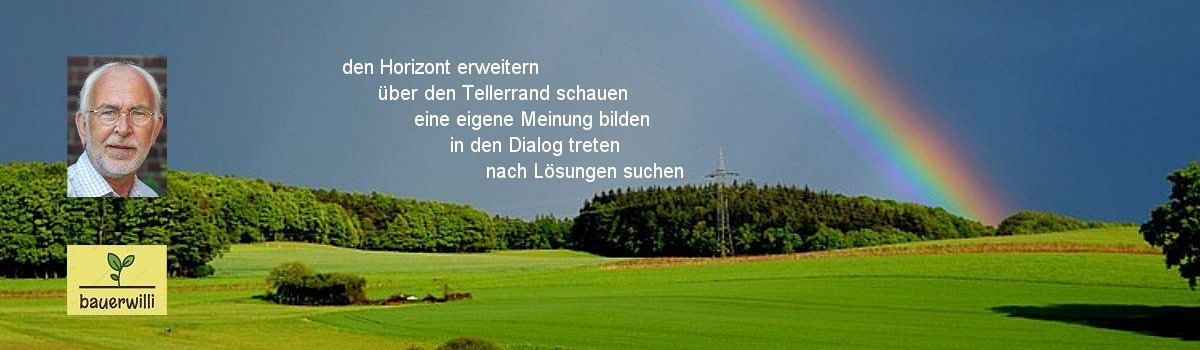

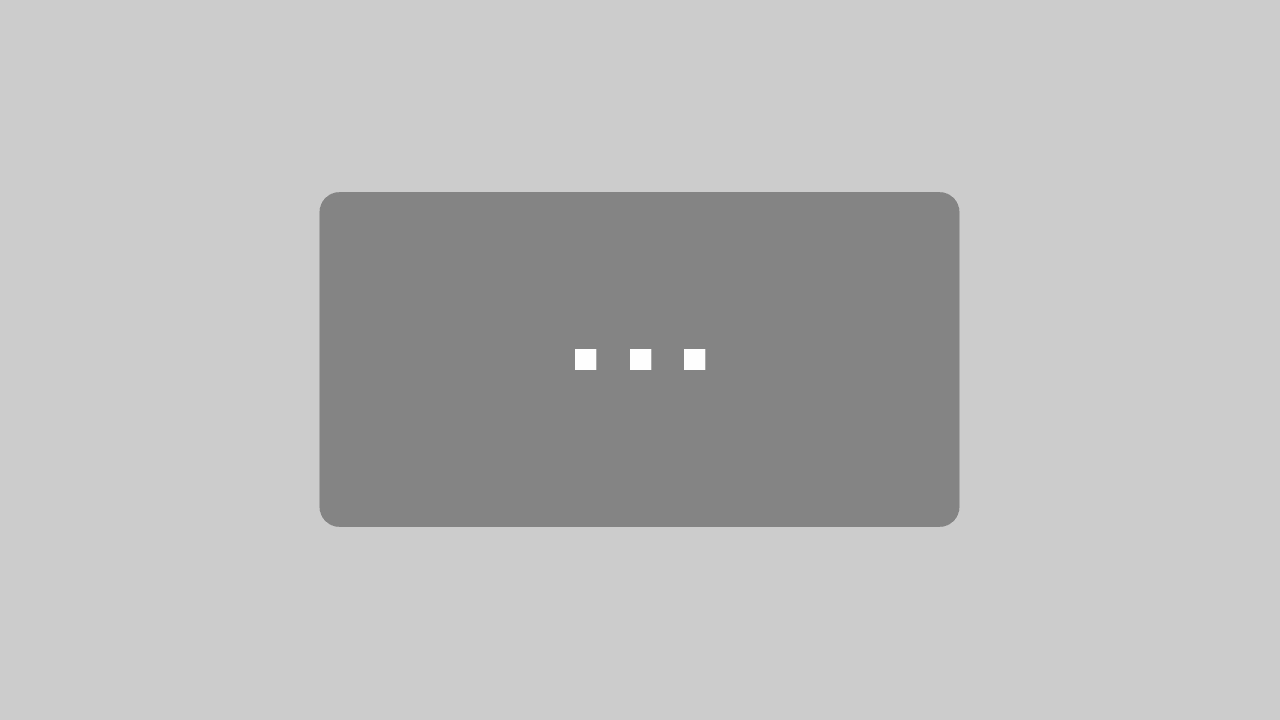
Die suchen bestimmt den Ansteller a an der Sense, Ehemaliger Labdwirt. oder?
Alles gut und schön. Nur wer soll es dauerhaft bezahlen. Wie sieht’s denn aus: Milliardensummen verschwinden in der Ukraine, wobei Rheinmetall bereits 40% höhere Preise für die Ersatzbeschaffungen angekündigt hat. Marode Wirtschaft durch Corona- und Energiekrise (selbstverschuldet), Krankenhauspleiten, Fehlbeträge in kommunalen Haushalten, usw. Schlägt man die Tageszeitung auf hat man den Eindruck die Welt besteht hauptsächlich aus Freizeitgestaltung, Konzerten, Bücherlesen und sonstigen kulturellen Errungenschaften. Und dann in der Politik noch eine Oppositionspartei die in der Krise des Landes Antworten geben müßte aber stattdessen mit sich selbst und ihrem Grundsatzprogramm beschäftigt ist. Fazit: Es geht uns offensichtlich noch zu gut!
Ja, es geht unseren Bürgern viel zu gut. 35 Jahre haben Lebensmittel bei uns fast nichts gekostet. Jetzt sind die Preise etwas angezogen und der Katzenjammer ist da, obwohl in (fast) keinem Land auf diesem Planeten so wenig gearbeitet muss für die Nahrungsmittel wie in Deutschland.
Jeder Bauer sein Biotop,
sind deswegen viele kleine Höfe ökologischer als wenig große?
Wenn die Bevölkerung das Bewußtsein dafür nicht hat ,
dann muss sie das den Fachleuten überlassen
Wiein anderen Bereichen auch.
Ja, viele kleine wären eigentlich von Vorteil. Doch der Wandel zu immer größeren Betrieben wird weitergehen.
Das stimmt so nicht Inga, Ich habe mir mal ein intensives Ackerbaugebiet im badischen vorgenommen und im Vergleich einen Großbetrieb in meiner Nachbarschaft. Ich habe rund 1000 ha als Ausschnitt genommen und über Luftbilder ausgemessen, wieviel ÖVF (ökologisch wirksame Vorrangflächen im Vergleich vorhanden sind. Wald und Siedlungsflächen habe ich außen vorgelassen. Auf dem Luftbild sieht die Landschaft in BW viel Bunter und kleinstrukturierter aus (durchschnittliche Schlaggröße 8,7,ha). Aber die tatsächlichen Landschaftselemente, die nicht von intensiver Nutzung betroffen sind (Streuobstwiesen, Feldränder, Säume an Feldwegen, Baumreihen und kleine Gehölzgruppen) machen hier in der untersuchten Fläche bei Seelow (durchschnittliche Schlaggröße 46 ha) am Rande des Oderbruchs 14 % aus,
in den Flächen in BW sind das 8,6 %.
Warum ist das so ?
Erstens sind die Felder der kleineren Betriebe auf Kante gepflügt und die Feldwege oft befestigt, manchmal, aber nur manchmal sind die Wege von einer schmalen Baumreihe gesäumt. Klassische Weg- und Feldränder und Haine kommen quasi nicht vor. Dafür gibt es dort relativ viele kleinere und mittlere Streuobstflächen, die bei Seelow quasi nicht vorkommen.
Insgesamt ist in den verglichenen Fällen aber eben so, dass die Landschaft bei Seelow viel weniger zersiedelt ist, und dass mehr Feldränder, Gehölzgruppen und Randstreifenfläche vorhanden ist.
Das ist nur ein ausgewähltes Beispiel und überall ist es etwas anders. Insgesamt ist die Herangehensweise beim Erhalt von Feld- und Wegrändern in diesem und anderen Großbetrieben etwas großzügiger als bei Betrieben mit begrenzter Fläche bei starkem Wettbewerb um die Ackerflächen. Da wird dann oft (notwendigerweise) sehr auf Kante geackert, weil auch einfach mehr Wertschöpfung je Hektar generiert werden muss (und wird)
Interessante Statistik. Die öffentliche Wahrnehmung ist aber eine andere: große Schläge = wenig Artenvielfalt. Dass in Seelow und Umgebung deutlich weniger Menschen leben und damit weniger Infrastrukturflächen benötigt werden, ist einem so nicht klar.
In Baden-Württemberg hat es aber einen grünen Minischter-Präsidenten und das gleicht vieles aus… 🙂
Im Beispiel oben ist nichts über Artenvielfalt ausgesagt. Es wird auch nichts über den Effekt großer Felder gesagt. Es wird lediglich gesagt, dass in Seelow aus den genannten Gründen (ich vermute auch mal wegen der Ertragsfähigkeit in Brandenburg) mehr Extensivflächen vorhanden sind als im BaWü Beispiel. Bitte nicht zu weit interpretieren.
Wenn extensivierte Flächen keine Wirkung haben, dann sollte man sie grundsätzlich auch nicht fordern. Oder müssen alle dauerhaft evaluiert werden, auch die, bei denen man es verordnet und entschädigt hat?
…und wenn herauskommt, dass es dem Artenschutz nicht hilft, wieder intensivieren und Geld zurück? Was für ein feuchter Traum.
Wir werden in BW noch genug Extensivflächen bekommen, mehr als der Bevölkerung und dem Artenschutz lieb ist.
Wir waren kürzlich in NRW in Urlaub, Lüdinghausen, eine wunderschöne Gegend. Beim spazieren gehen habe ich Baumreihen mit Unterholz am Rande von Wiesen gesehen… wären diese bei uns im Klettgau, dann wäre die Wiese schon zur Hälfte weg… und der Rest beschattet :). Über das Minischter Dings möchte ich mich nicht äussern.
Um von der REWE Diskussion wegzukommen, möchte ich auf einen anderen Missstand hinweisen.
In der Natur, kommt jedes Tier, ob Insekt oder Elefant dort vor, wo es genügend Nahrung gibt und das Klima für diese Art geeignet ist. Manche Insekten, welche einen Schaden anrichten, kommen nur, wie der Rüsselkäfer bei der Zuckerrübe oder jener im Wald an den Jungpflanzen nur in der Paarungszeit und während der Eiablage vor.
Jede Pflanze wächst dort, wo der Standort für diese geeignet ist. Die Bauern müssen, der Betriebsgröße entsprechend, Flächen als Blühwiesen nicht abmähen sondern erst im Herbst behandeln. Sehr häufig werden “saure Wiesen”, um dieser Verordnung gerecht zu werden, dafür unbehandelt belassen. Die Gräser sind dort Windblütler, aber wen kümmert dies schon.
Alles nur Show.
Johann Pichler
@Johann Pichler
Bauern müssen die Wiesen auch überhaupt nicht abmähen…
Oder anders: wer kümmert sich um die Landschaft, wenn die Bauern weg sind?
Vielen Dank, dass sie uns darauf hin weisen, dass jedes Tier sein Habitat braucht, ohne ihr Wissen wäre ich bestimmt mal unwissend verstorben.
Ihr letzter Abschnitt irritiert mich, mit was sollen wir Blühwiesen im Herbst behandeln?
Mir wurde eine “saure Wiese” unter Denkmalschutz gestellt, die Menschen, die mit dem Laptop über meine Weise rennen und ungefragt die Wiese als Biotop nach § 24 Naturschutzgesetz eingestuft haben, können mit der Sense kommen und die Wiese so pflegen, wie sie es für richtig halten, ich mache nicht mehr.
Die suchen bestimmt den Ansteller a an der Sense
Die Frage wäre noch offen, ob die Wissen, was eine Sense ist.
Dengelstock und Hammer könnte ich denen noch zur Verfügung stellen.
https://m.bild.de/regional/hamburg/hamburg-aktuell/er-kaempft-gegen-milliarden-firma-in-seinem-dorf-schafzuechter-lehnt-1-5-mio-eur-85106174.bildMobile.html?t_ref=android-app%3A%2F%2Fcom.google.android.googlequicksearchbox%2F
Was ist nun, Natur bewahren oder Weltrettung mit E-Autos?
Ein schönes Interview, das viele Zusammenhänge anspricht Aber “Naturschutz – anders gedacht” ist es keineswegs. es sind alles bekannte Dinge, die jeder, der ernsthaft mit Naturschutz zu tun hat, kennt. ( Ich arbeite im behördlich/wissenschaftlichen Naturschutz, da sind Unterschiede zu links-ideologischem Politikerzeug und auch zu den natürlichen überspitzten Forderungen so mancher Naturschutzverbände…) .
Also als Begründung für hämische Kommentare a la die “Naturschützer” haben es nur noch nicht verstanden” taugt das Interview sicher nicht.
Das Grundübel “Überbevolkerung” bleibt und wird zwangsläufig so enden, wie jede Bakterienkultur auf einer Petrischale im Labor Sobald alle Ressourcen aufgefressen sind, bricht die Population zusammen und basta.
Ich habe an zwei mehrtägigen Workshops des BfN auf der Insel Vilm teilgenommen. Als Landwirt mit 20 Naturschützern. War für beide Seiten lehrreich. Konsequenzen hatte es keine. Leider.
Wenn man konsequent befolgt: “Die Äcker lassen sich nicht, auch nicht im Ökoanbau, auf das Ertragsniveau und die geringen Bestandsdichten des 19. Jahrhunderts “zurückextensivieren”, die die hohe Biodiversität dieser Zeit ermöglicht haben. ist die Konsequenz eigentlich Intensivierung über Präzisionslandwirtschaft in den Produktionsflächen.. Vertragsnaturschutz und Habitatgestaltung auf nicht produktiven Flächenanteilen und in vorhandenen Landschaftsstrukturen können die Biodiversität steigern und erhalten.
Ich bin für Produktivitätscluster mit maximaler Nutzung von Gunstflächen und ersatztweise stärkeren Ausbau von Landschaftsstruktur in den Gebieten mit den schlechteren Böden.
Das mag strittig sein, vor allem für intensive Betriebe auf leichten Böden, und darf daher auch kein von obeb verordneter Zwang sein, sondern “bezahlter Betriebszweig” auf freiwilliger Basis.
Den Fatalismus des Petrischalenbeispiels teile ich nicht, wohl wissend, das diese Einstellung in “Naturschützerkreisen” verbreitet ist. Nur dann brauchen wir in letzter Konsequenz auch keinen Naturschutz und die “Natur” regelt unseren Niedergang schon selbst … und die Erde hat danach endlich ihre wohlverdiente Ruhe … im Kästnerschen Sinne.
Diese Einstellung finde ich zynisch und Zynismus hilft Niemandem.
Das Problem ist, dass sich verschiedenste Gruppen eine unterschiedliche “Natur” als Idealform vorstellen. Jeder Nutzer in dieser Gesellschaft hat sein Wunschpaket. Da kommt nur eine verstärkte Form der Burokratisierung, Dokumentation, Kontrolle und Digitalisierung heraus. Letzteres wird bereits als Lösung angesehen….nee, ich bin Zyniker: Das wird nix in einer gewünschten high-tech Gesellschaft.
Hab gerade nochmal “Zynismus” gegoogelt und dabei mein Vorurteil bestätigt gefunden, dass mein Gemecker die aktuell höchste Stufe der Ideologiekritik erreicht hat. Tusch! 😉
https://www.nzz.ch/feuilleton/35-jahre-nach-der-kritik-der-zynischen-vernunft-peter-sloterdijk-analysiert-das-zynische-bewusstsein-zu-beginn-des-21-jahrhunderts-ld.1447498
“Sie kulminiert in der marxistisch inspirierten Kritik der proletarischen und kleinbürgerlichen Weltauffassungen.
Schliesslich mündet sie um die Mitte des 20. Jahrhunderts in die Kritik der «Bewusstseinsindustrie» geldgetriebener Massengesellschaften. ”
BTW: “Kritik der zynischen Vernunft” als Buch. (damals hat Meister Sloterdijk noch halbwegs verständliche Texte produziert, Mediziener bekommen auch ihr Fett weg…
“Ich bin für Produktivitätscluster mit maximaler Nutzung von Gunstflächen und ersatzweise stärkeren Ausbau von Landschaftsstruktur in den Gebieten mit den schlechteren Böden.”
Genau das ist die Grundidee von Prof. Kunz, wofür er von den kommerziellen “Naturschützern” beschimpft wird. Der gezielte Ausbau von Struktur ist nämlich richtig Arbeit, es kostet einen finanziellen Ausgleich und, was das “Schlimmste” ist: man muss sich mit den Bauern unterhalten und eine Einigung finden…
Das Ganze scheitert spätestens dann, wenn der föderale Gerechtigkeitsirrsinn zuschlägt.
Wenn die Sache klappen soll, dann muss man sich dazu durchringen bestimmte Regionen nur für Natur, oder Agrarproduktion, oder Wohnen und Wirtschaften auszuweisen. Das scheitert am Deutschen Wesen.
Bedeutet das, wir legen bei uns in der Oberpfalz dann alles still und werden nur noch “Landschaftsstruktur”?
Ja, z.B…..oder ihr bewerbt euch für einen Standort für eine Chipfabrik, oder eine Batteriefabrik oder für die größte PV-Freiflächenanlage Deutschlands….irgendetwas wird ja wohl möglich sein.😎…..außer umweltschädlicher Landwirtschaft.😉
Letzteres gilt auch für die naturschützer
https://www.youtube.com/watch?v=NWArqSuL5C4&t=111s
Dieses Video sollten auch Schulklassen ab 7. oder 8. Klasse im Unterricht gezeigt bekommen.
Dies ist von Prof Dr Werner Kunz bestens erklärt.
Natürlich sollte das zum Pflichtprogram für jeden Auszubildenden in der Landwirtschaft gehören.
Ich kenne die Denkweise von Prof. Dr. Werner Kunz schon seit vielen Jahren. Und ja, ich würde es begrüßen wenn mehr von uns Bauern bereit wären, mehr spezielle Habitate für diverse Arten anzulegen. Von wo die Förderung kommt ist letztendlich egal. Doch ohne wird das nix, wie ihr wisst. In 2021 hatte ich noch 14 vernetzte Biotope in meiner Gemeinde angelegt. Gesamtfläche von 143.450 Quadratmeter; 14,3ha. Natürlich hat jeder seine eigene Meinung und das ist auch gut so. Doch mitzuerleben wie sich Artenvielfalt steigern lässt hat auch was. Und in Jahren mit Vorsommertrockenheit ist natürlich der DB deutlich über Getreide.
Sehr wohltuend ist, dass Kunz nicht in das populistisch, alarmistischen Apokalypsengeheul verfällt wie viele seiner karriere-gailen Kollegen. Seine Aussagen bezüglich der LW sind in Ordnung. Trotzdem würde ich dem Herrn Professor gerne folgende Fragen stellen.
1. Wieviel Artensterben gibt es wirklich?
2. Wird Artensterben nicht häufig mit Artenverdrängung oder Arten”wanderung” verwechselt? (So wie Arten bei uns einwandern können ja auch welche ausswandern wenn sich beispielsweise Standortbedingungen verändern oder global verschieben)
3. Wieviel Artenvielfalt brauchen wir wirklich? (muss es immer maximale Artenvielfalt sein?)
4. Auch seine Vorstellung von Artenschutz ist nichts anderes als menschliche Naturmodellierung. Wann ist die Natur richtig modelliert und wer entscheidet dies?
z.b.waschbären…..hier gibt es Unmengen! ich hab allein 5 fähen gefangen! das sind pro Jahr mind. 30 nachkommen und es sind immer noch welche aktiv.
die haben bei mir mind. 6 hühner geholt….möchte nicht mehr wissen was die an Singvögeln, Insekten und Amphibien abräumen!
Von Prof. Kunz stammt auch die Aussage:
“Auf ganz Europa betrachtet ist keine einzige Vogelart vom Aussterben bedroht”.
Ich denke auch, das es aus verschiedensten Gründen Verschiebungen im Verbreitungsgebiet geben kann. Z.B. ist der Rotmilan in Spanien ein sehr häufiger Vogel.
Und manchmal nützen alle Maßnahmen nichts, manche Viecher verschwinden in manchen Gegenden … und nicht immer kann man erklären warum.
Die noch weiter zunehmenden Nutzungskonflikte in Verbindung mit dem zunehmenden Druck aus allen Richtungen von Arten-, Biodiversitäts- Klima-, Wasser- Schutz…. werden dieses Land verstärkt lähmen und den Konflikt zwischen den gesellschafichen Gruppen verstärken,….nicht verringern, wie häufig gedacht wird, um dann schnellstmöglich ein Friedensangebot zu unterbreiten (siehe ZKL).
Milane gibt es hier mittlerweile zuhauf. Beim Pflügen oder Mähen oft 5,6 Stück zu sehen.Seltsamerweise sind Mäusebussarde die früher in ähnlichen Stückzahlen zu beobachten
waren kaum noch zu sehen,warum auch immer.
Nur meine subjektive Beobachtung.
Bei uns Mäusebussarde zuhauf. Oft drei gleichzeitig über dem Hof zu sehen. Die wollen auch nicht in die Eifel, denen sind da zu viel Milane… 🙂
Kontext? Waschbären sind EU-weit als invasive Art eingestuft und da ein europaweites Ausrotten, welches naturschutzfachlich gewünscht wäre, nicht mehr realistisch ist, wird zumindest in NSG die Jagd auf Waschbären regelmäßig als Schutzmaßnahme für bodenbrütende Vogelarten oder auch heimische Krebse und Muscheln vorgesehen.
Wer entscheidet, welche Art ausgerottet werden muss und welche nicht?
nu ja, Naturschützer denken oft sehr konservativ und wollen alte Zustände bewahren. In dem Fall die Arten, die sich seit der letzten Eiszeit hier wiederfinden. Alle sich neu (nach Kolumbus entdeckt Amerika) ausbreitenden Arten werden da sehr skeptisch gesehen und man wünscht sich die idealisierte extensive Landnutzung des frühen 19. Jahrhunderts zurück.
Dem könnte man entgegnen “die Zeit schreitet voran, lass die Evolution doch mal machen”
Aber tatsächlich sind viele der Neuen nur durch die rasende menschliche Globalisierung hier eingetroffen (wie auch der Waschbär) und die Gefahr, dass viele einmalige Lebensgemeinschaften, die sich nur hier lokal über Jahrtausende entwickelt haben, nun durch due Invasoren in kürzester Zeit ausgelöscht werden, ist real.
Wollen wir zukünftig noch heimische Artenvielfalt mit Europäischem Flusskrebs, rotem Eichhörnchen und vielen anderen oder lassen wir zu, dass zukünftig in weiten Teilen der Welt einige wenige Invasive Allerweltsarten wie Amerikanischer Flusskrebs, Grauhörnchen, Schwarzmeergrundel und Japanischer Staudenknöterich alles verdrängen und dominieren?
Anderer Aspekt natürlich die Wirtschaftlichkeit…Und da muss man den Betroffenen noch nicht mal Boshaftigkeit oder Bequemlichkeit unterstellen. Wirtschaftlichen Schaden will Niemand.
Nutrias zerstören Deiche (und Röhricht)… Müssen weg. Der Bieber setzt meinen Acker unter Wasser, das geht nicht. Kormoran, Fischotter fressen meine Fische. Das braucht kein Mensch. Und der böse Wolf erst, ein ganz übler Zielkonflikt mit der auch für Naturschutz höchst wertvollen Wanderschäferei und extrem emotional als Konflikt zwischen Stadtmenschen und Landmenschen. Alles wahr und nicht mal eben lösbar. Aber noch vielmehr in anderen Teilen der Welt: Die Elefanten trampeln meinen Mais um. Wegen dem Tiger kann ich keinen Honig mehr im Wald sammeln, Wer entscheidet, was Vorrang hat?
Wir kommen gerade mit den Enkel vom Ausflug an den Rhein. In den Bäumen Sittiche, den ganzen Baum voll. Auf der Wiese stehen 5 Walnussbäume, von denen wir seit 5 Jahren nichts mehr ernten. Walnussfliege.
Was den Wolf angeht: Die Schizophrenität der Gesellschaft ist einfach unehrlich: Alle wollen die Tiere auf der Weide sehen, aber den Wolf wollen auch alle. Es geht nur eines davon.
Sie werden eh schon ehrlicher: Wo es in den Alpen mit dem Wolf nicht geht, sollen die Almbauern verschwinden, sagen sie. Ihnen ist eh Wildnis am liebsten. Und wer isst schon Schaffleisch, ist die allgemeine Meinung. Dabei kann Ö. seinen Bedarf gar nicht selber decken.
Frau Ertl,
wer ist schon Schaffleisch, im Supermarkt gibt es nur Lammfleisch.😉
Hauptsache alle Gesellschaften einigen sich darauf die richtigen Arten in ihren Landesgrenzen zu erhalten, nicht dass es welche doppelt gibt oder eine Art komplett vergessen wird. Und hoffentlich werden in rechten Regierungen die “richtigen” Arten geschützt….das wird kompliziert. 😳
Staatliche Natürschützer denken zuerst an ihren gut bezahlten Job!
Die können gar nicht wirtschaftlich denken.
Ich möchte mal so Urlaub machen, wie diese Leute ihren “Arbeitstag” hinter sich bringen.
Das muß auch so sein, denn die waren schon eher in unserer Evolution als die Waschbären.
Ist die Veränderungen durch die erwünscht? Sie sind ja erst seit fast 80 Jahren hier!
Zum Artenrückgang gibt es ganz klare Untersuchungen und die sind verblüffend, denn der größte Verlust von Tagfaltern ist in Naturschutzgebieten. Also kein Landschaftsschutzgebiet. Google einfach mal Vorträge Prof. Dr. Werner Kunz und Du bekommst viel Infos wenn mal wieder auf uns Bauern eingedroschen wird. Landwirte sind nur das 4 größte Problem des Artenrückgangs. Damit kannst Du punkten.
Entweder sind meine Ohren kaputt oder die Kopfhörer oder es ist eine schlechte Aufnahme….keine Ahnung, jedenfalls ist es nicht gut bzw. gar nicht verständlich.
Die Aufnahme ist o.K.
Jooo, jetzt klappt es…warum auch immer.👍
Die Biologische Station hier pocht auf Einhaltung der vorgegebenen Statuten!
Die höchste Kiebitzpopulation (nach Angaben der Biostation) hatte ich nach Glyphosateinsatz und später Aussaat von Sommergerste.
Das neuste ist ein Schröpfschnitt in 40cm Höhe,der praktisch nicht funktioniert!
Kiebitze habe ich letztens hier nach der Rollrasenernte in Massen gesehen.
ist doch auch kein Widerspruch ? Kibitze mögen offene Strukturen. Brüten auch im Kies auf Flachdächern von Gewerbegebieten. Ob sie den Nachwuchs dann aber erfolgreich großziehen können, entscheidet sich später. Gibt es Futter für die Jungen, Deckung vor Fressfeinden usw. Das Glyphosat und Rollrasen nichts tolles für die Natur sind, sollte wohl trotz solcher Beobachtungen jedem klar sein.
Das sind Akademiker, wie sollten die Ahnung davon haben, wenns nicht in ihren Büchern stehen. Und mißtrauen dem Wissen, dass wir Bauern in so vielen Jahren Praxis gesammelt haben.
guten Morgen und schönen Sonntag ich werde das wie Video sehr schön verbreiten und ich bin nach wie vor der Meinung dass Werder Bremen ein toller Fußballverein ist auch wenn sie gegen Bayern verloren haben weiter bin ich der Meinung dass sie Landwirte sehr guten Naturschutz betreiben und überhaupt viele gute Dinge machen
Natürlich kann effektiver Naturschutz nur mit den Landwirten geschehen und nicht gegen sie!
Denn sie bearbeiten ja die Flur
Echte Naturschützer wissen das!
Möchtegern Naturschüzuer eben nicht!
Deswegen müssen die auf sich aufmerksam und und Schulzuweisungen machen.